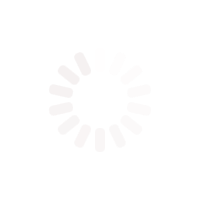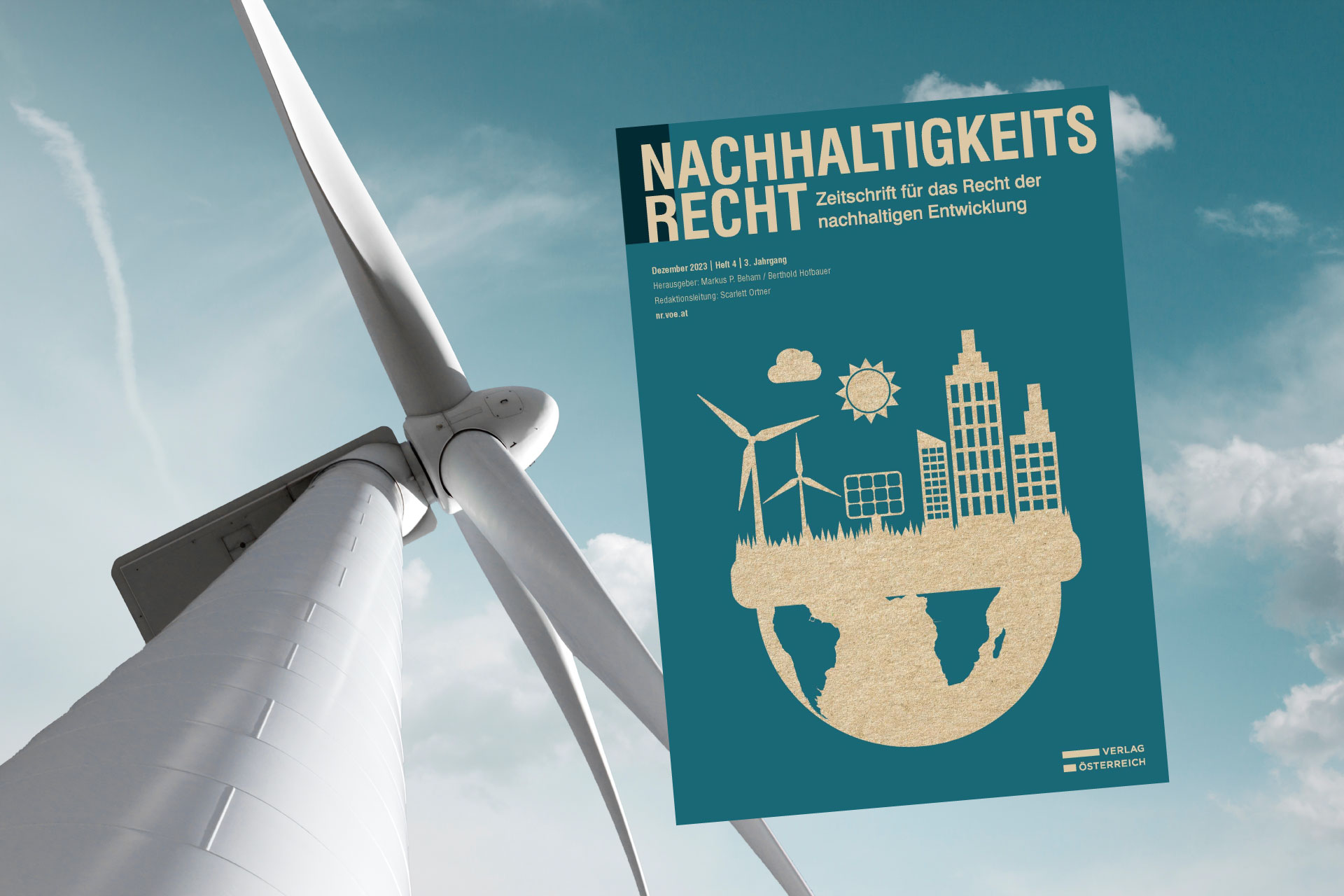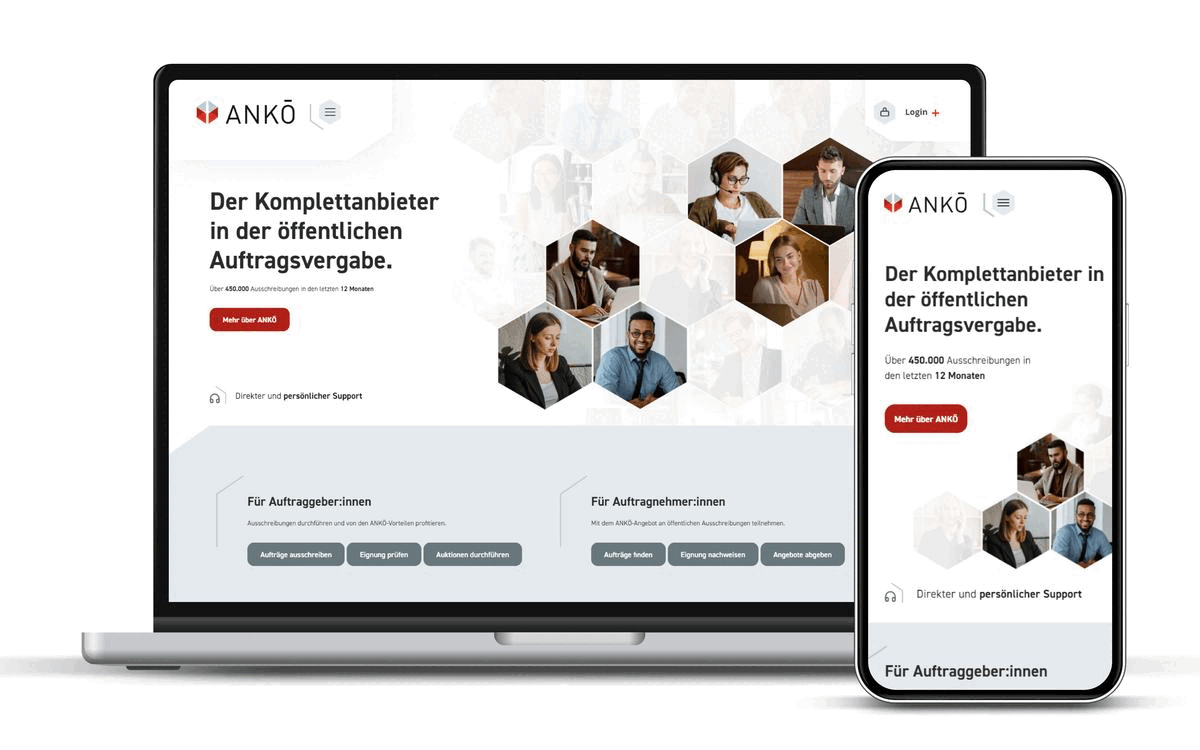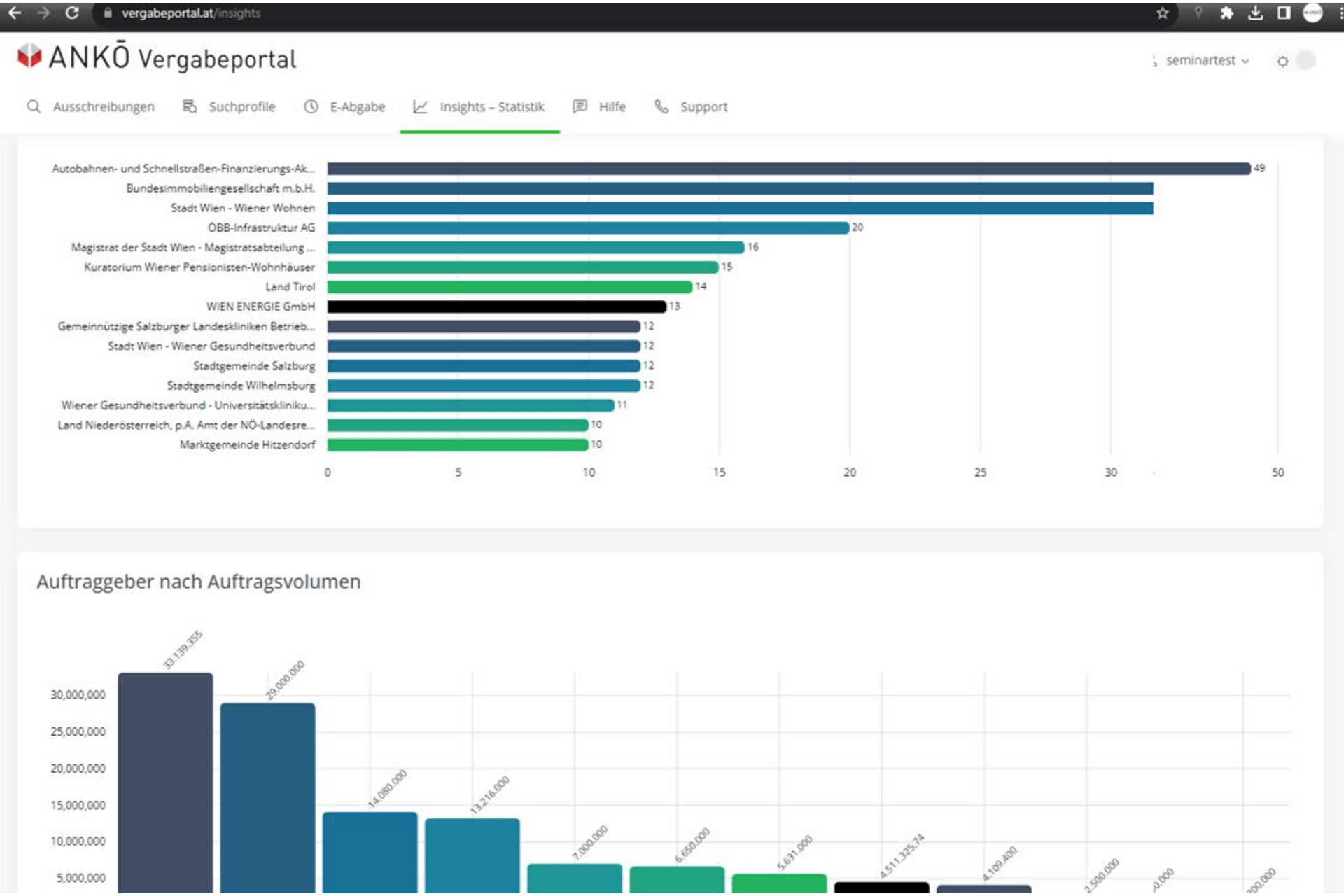Alle News


- Alle News
- Für Auftraggeber:innen
- Für Auftragnehmer:innen
- Veranstaltungen
- eGov
- LgU
- Nachhaltigkeit
- Vergabeportal
- eVergabe+
- ANKÖ Akademie
- Vergaberecht
- EU
- CPV-Code
- Eignung
- Eignungsnachweis
- Studie
- Schwellenwerte
- eForms
- Umfrage
- Redesign